Artikel aus der Stuttgarter Zeitung
12.01.2025 – 18:00 Uhr – Hilmar Pfister
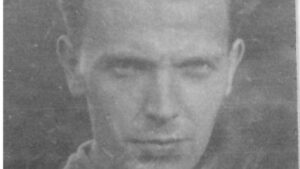
Alfred Broghammer. Foto:
Er stellte sich den Nazis entgegen und bezahlte dafür mit dem Tod. Alfred Broghammer wurde 1939 verhaftet und starb auf dem Hohenasperg.
Wenn man sich das gerahmte Porträt von Alfred Broghammer anschaut, dann sieht man einen jungen Mann in seinen Zwanzigern mit entschlossenem, ernstem Blick, das volle Haar nach hinten gekämmt. Einen jungen Mann, der das Leid dieser Welt kennt, es selbst erlebt hat und sich ihm trotzdem entgegenstellt.
Von Anfang an gepeinigt
Mit dieser Entschlossenheit bestritt er sein kurzes Leben. Diese Entschlossenheit brachte ihm den Tod. Alfred Broghammer wurde am 2. Juni 1911 in Stuttgart geboren. Der Vater Thomas hatte die Familie früh verlassen. Mutter Rosine Broghammer und ihr Sohn Alfred wohnten in der Möhringer Straße 71 in Stuttgart-Süd, nahe dem heutigen Erwin-Schöttle-Platz. Sie leben dort in einfachsten Verhältnissen.
Der Vater unterstützt sie kaum – weder mit Geld noch mit persönlicher Anwesenheit. Für Rosine Broghammer und ihren Sohn Alfred ist der Ex-Ehemann und Vater schlicht nicht existent. Und so bestreitet sie den Lebensunterhalt für sich und den kleinen Fred, wie Alfred von allen genannt wurde, mit Putzen und Nähen. Der kleine Fred weiß von Anfang an, was Schmerzen sind. Eine Rückenmarksverletzung peinigt ihn unerlässlich, Tag für Tag. So sehr, dass er zeitweise das Bett nicht verlassen kann.
Woher die Rückenmarksverletzung kam? Alfred sagte später einmal, der eigene Vater habe sie ihm zugefügt, als er ihn misshandelte. Immer wieder. Die Verletzung trägt zur Not der vaterlosen Familie bei. Diese Not zieht sich durch die Jahre wie ein roter Faden. Ohne die Hilfe seiner Freundin Gertrud Hafner kann Alfred sich ab 1933, als er 21 Jahre wird, kaum über Wasser halten. Gertrud Hafner wohnt in der Strohbergstraße, nur wenige Gehminuten von Alfred entfernt, im heutigen Lehenviertel.
Der junge Alfred Broghammer arbeitet als Journalist. Das bringt ihm nur wenig Geld ein. Als freier Journalist kann er nur wenige Artikel bei zahlungswilligen Kunden unterbringen. Aufgrund seiner politischen Einstellung scheitern auch sämtliche Versuche, eine Festanstellung bei einer großen Zeitung zu ergattern.
Doch was war seine politische Einstellung? Dazu braucht man sich nur noch einmal das gerahmte Porträtfoto von Alfred Broghammer anschauen. Mit dieser Entschlossenheit im Blick stellt er sich auch allem entgegen, was dem politischen Massengeschmack blind hinterherläuft. Schon vor 1933 hatte Alfred Broghammer Verbindung zum kommunistischen Jugendverband. Nach 1933 hält er Kontakt zu jungen Menschen aus bündischen und katholischen Jugendgruppen, die sich nicht vom NS-Regime vereinnahmen lassen wollten. Die genauso entschlossen sind wie er.
Die bündische Jugend war in der Weimarer Republik entstanden, als Vereinigung aller Jugendverbände, die politische unabhängig und konfessionell ungebunden waren. Vor allem Pfadfinder und Wandervögel. Ihr wichtigstes Ziel war die Rückbesinnung auf die Natur. Ganz genau lässt es sich nicht mehr recherchieren, aber zumindest teilweise hält Alfred Broghammer diesen Kontakt über die damals in Freiburg ansässige „Christliche Buchhandlung Wichernhaus“ mit angegliederter Druckerei und Kleinverlagen. „In Kontakt bleiben“ bedeutet damals nicht etwa WhatsApp-Nachrichten schicken, sondern Briefe schreiben.
In dieser Zeit entsteht auch die Verbindung zur Gruppe um den Bonner Studenten Michael Jovy, die im gesamten Reich Freunde und Unterstützer hat. Zu diesem Freundeskreis zählt neben Alfred Broghammer auch Ernst Reden, der im Herbst 1935 nach Ulm zur Wehrmacht eingezogen wird. Warum Ernst Reden an dieser Stelle Erwähnung findet? Weil er dort in Ulm in der Wehrmacht zusammen mit Hans Scholl versucht, Formen und Gedanken der bündischen Jugend in der Hitlerjugend zu etablieren. Scholl, der hier erstmals in Konflikt mit dem Nationalsozialismus gerät, und seine Geschwister werden deshalb kurzzeitig inhaftiert, Ernst Reden landet für drei Monate im Gefängnis. Das weitere Schicksal der Scholl-Geschwister ist zum schmerzlichen Baustein der deutschen Geschichtsaufarbeitung geworden.
Doch zurück zur Gruppe um den Bonner Studenten Michael Jovy. Als sie Ende 1939 auffliegt, wird auch Alfred Broghammer in Stuttgart verhaftet und etwa ein halbes Jahr von der Gestapo festgehalten. Und hier sind sie wieder, die Schmerzen, die schon der kleine Fred kannte und denen sich auch der erwachsene Alfred stellt. Die Verhöre finden im Hotel Silber statt. Alfred Broghammer wird zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Man will ihn ins Zuchthaus in Ludwigsburg schicken. Doch zuvor war er für etwas anderes bestimmt. Der Bosch-Konzern hatte im Zuchthaus Ludwigsburg eine Art „Zweigwerk“ eingerichtet, in dem die Arbeitskraft der Häftlinge für die Rüstungswirtschaft genutzt wurde. Der Tageslohn beträgt 40 Pfennige. Die Häftlinge müssen Anker für verschiedene Typen von Lichtmaschinen wickeln. Dort landet auch Alfred Broghammer. Bei der Arbeit im feuchten Keller des „Zweigwerks“ erkrankt er an Tuberkulose. Nach kurzem Spitalaufenthalt wird er auf den Hohenasperg verlegt, wo er am 21. Juli 1943 stirbt. Seine Mutter, Rosine Broghammer, erfährt nicht von seinem Tod. Sie war bereits am 27. Juni 1943 gestorben.
Am 18. November 1982 ehrte die jüdische Gedenkstätte Yad Vashem Michael Jovy als Gerechten unter den Völkern. Der israelische Botschafter sprach damals zu Ehren von Michael Jovy in Rom folgende Worte: „Ein mutiger Deutscher, einer von denen, die es wagten, die Kräfte des Bösen herauszufordern.“
Diese Worte, sie gelten auch für Alfred Broghammer, geboren am 2. Juni 1911 in Stuttgart, gestorben am 21. Juli 1943 auf dem Hohenasperg im Kreis Ludwigsburg.




