 Wenn Emil Markus über seinen ermordeten Vater spricht, dann lächelt er beinahe. Mit fast bestürzender Sanftheit lässt der 90jährige eine dramatische Biografie vorbeiziehen, während im Garten seines Reihenhauses ein Brunnen plätschert und zwischendurch ein Enkel anruft, um Opa vom Erfolg bei der letzten Klassenarbeit zu berichten. “Wir haben hier eine sehr gute Nachbarschaft”, sagt Emil Markus, und benennt damit vielleicht das Lebenselixier, das ihn trotz schlimmster Erfahrung davor bewahrt hat, ein verbitterter Mensch zu werden: Zusammenhalt mit anderen.
Wenn Emil Markus über seinen ermordeten Vater spricht, dann lächelt er beinahe. Mit fast bestürzender Sanftheit lässt der 90jährige eine dramatische Biografie vorbeiziehen, während im Garten seines Reihenhauses ein Brunnen plätschert und zwischendurch ein Enkel anruft, um Opa vom Erfolg bei der letzten Klassenarbeit zu berichten. “Wir haben hier eine sehr gute Nachbarschaft”, sagt Emil Markus, und benennt damit vielleicht das Lebenselixier, das ihn trotz schlimmster Erfahrung davor bewahrt hat, ein verbitterter Mensch zu werden: Zusammenhalt mit anderen.
“Mein Vater Emil Markus wurde am 3. Januar 1887 im schlesischen Kempen geboren; seine Eltern waren beide Juden, aber für ihn spielte diese Herkunft keine Rolle. Er hat keine Synagogen besucht, und ob er überhaupt irgendeinen religiösen Glauben hatte, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich war ihm das ganze Thema schlichtweg egal – anders übrigens als unserer Mutter. Die war eine evangelische Münchnerin, und sie hat es abgelehnt, mich und meine Schwester jüdisch erziehen zu lassen. Das wäre der Wunsch meiner Großmutter gewesen. Sie hätte die Kinder ihres Sohnes gerne als Juden aufwachsen sehen und hat meinen Eltern sogar finanzielle Unterstützung angeboten, wenn sie uns jüdisch-religiös erzogen hätten. Aber wie gesagt: unsere Mutter wollte nicht, Vater war es wohl egal, und so wuchsen meine Schwester und ich ohne einen Hauch jüdischer Kultur auf. Erst in der Grundschule, die auch evangelisch war, hörte ich von so genannten “Israeliten”. Als ich zu Hause von diesen fremd klingenden Wesen berichtete, verblüffte mich meine Mutter mit der Antwort: “Du weißt doch, Vater ist auch ein Israelit.” Vater ein was? Ich konnte mir nichts darunter vorstellen und habe nicht weiter darüber nachgedacht.
Meine Freunde waren ein bunter Haufen jüdischer und nichtjüdischer Buben. Wir klauten sommers Kirschen im Dachswald und kämpften an der Schillereiche mit Holzschwertern gegen Jungs aus anderen Cliquen. Oft spielte ich auch mit den Söhnen des evangelischen Pfarrers Langbein von der Leonhardtskirche in dessen Pfarrgarten in der Heusteigstraße.
Einmal haben wir uns von dort in die benachbarte Schnapsfabrik geschlichen, die einem Juden gehörte. Als der Inhaber uns entdeckte, gab es aber keine schlimme Szene, sondern er hat uns ganz großzügig angeboten, von seinen Schnäpsen zu probieren – schneller hätte er uns auch mit einer Schimpfkanonade nicht vertreiben können.
Eine deutsch-nationale Grundeinstellung war überall selbstverständlich, auch in der Schule. An nationalen Gedenktagen trug ich, wie alle Jungs in meiner Klasse, eine schwarz-weiß-rote Stecknadel am Revers. Dem Vaterland erwies ich sogar dann die Ehre, wenn niemand es sehen konnte: An lauen Sommerabenden saß ich oft allein am Fenster unserer Wohnung im vierten Stock der Heusteigstraße und lauschte der Musik, die aus den Biergärten der Silberburg über die Dächer zu mir herüberwehte. Wenn dort die nationalen Verbände das Deutschlandlied anstimmten, stand ich immer zackig auf – selbst ohne Augenzeugen fand ich, diesen Respekt der Nationalhymne schuldig zu sein.
Mein Vater dachte ähnlich. Dass er als Jude in seinem hoch geschätzten Vaterland plötzlich unerwünscht sein sollte, war ihm unvorstellbar. Gab es irgendwo die Aufschrift “Für Juden verboten”, ignorierte er das Schild einfach – er fühlte sich nicht angesprochen. Wir alle dachten außerdem, Vater sei sicher, weil er als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte, mit militärischen Auszeichnungen.
 Ein Foto zeigt ihn in der Uniform des Grenadierregiments “Königin Olga”, erkenntlich an der Krone und dem “O” auf dem Schulterstück. Das war die Eliteeinheit in Stuttgart, und er war stolz, dazu zu gehören. Allerdings hat ihn das Erlebnis des Krieges geändert. Nachdem er mit eigenen Augen gesehen hatte, was Krieg bedeutet, war seine patriotische Begeisterung ziemlich gedämpft. Er sympathisierte mit den Sozialdemokraten. Und wenn er später über die Nazis schimpfte, dann wegen seiner politischen Überzeugung.
Ein Foto zeigt ihn in der Uniform des Grenadierregiments “Königin Olga”, erkenntlich an der Krone und dem “O” auf dem Schulterstück. Das war die Eliteeinheit in Stuttgart, und er war stolz, dazu zu gehören. Allerdings hat ihn das Erlebnis des Krieges geändert. Nachdem er mit eigenen Augen gesehen hatte, was Krieg bedeutet, war seine patriotische Begeisterung ziemlich gedämpft. Er sympathisierte mit den Sozialdemokraten. Und wenn er später über die Nazis schimpfte, dann wegen seiner politischen Überzeugung.
Unter Hitler wurde das allgemeine Klima immer bedrohlicher. Vor allem mein Vater hatte schnell lernen müssen, dass sein Leben in Deutschland nie mehr das gleiche sein würde wie vor 1933. Überall wurde er von den alltäglichsten Verrichtungen ausgeschlossen. Schon im Frühjahr 1933 sagte ihm sein langjähriger Frisör, er könne ihn jetzt nicht mehr rasieren, weil andere Stammkunden sonst mit einem Boykott drohten. Mein Vater konnte sich kaum noch in der Öffentlichkeit bewegen, und jegliche gemeinsame Unternehmung mit Frau und Kindern – Kinos, Cafes, Ausflüge – wurden in der haßerfüllten Atmosphäre der Naziherrschaft unmöglich. Von den vielen Schikanen und Gemeinheiten, die ihm begegneten, hat ihn wohl nichts so sehr getroffen wie der Rauswurf aus dem Gesangsverein. Das dortige Musizieren war seine liebste Freizeitbeschäftigung gewesen. Jedes Jahr schenkte ihm meine Mutter zu Weihnachten eine neue Mundharmonika, und einmal pro Woche hatte er in dem prächtigen Gründerzeitgebäude in der Heusteigstraße, wo später der provisorische Landtag tagte, seine Kameraden vom Gesangsverein getroffen. War er samstags früh besonders gut gelaunt, brachte er uns zuhause die neuen Lieder vom Vorabend zu Gehör. All das war im Frühjahr 1933 mit einem Schlag vorbei.
Als Ehemann einer Deutschen aber blieb er lange vom Schlimmsten verschont. Er musste nie den Judenstern tragen, und bis zu seiner Deportation lebte er immerhin mitten in Stuttgart – wenn auch unter jämmerlichen Bedingungen. Seine Textilfirma hatte die Weltwirtschaftskrise nicht überstanden, und so bezog er staatliche Unterstützung. Im Gegenzug musste er als Hilfsarbeiter so genannte Pflichtarbeit leisten. Abends stand er quasi unter Hausarrest, denn Angst, Geldnot und viele gesetzliche Verbote schlossen ihn vom öffentlichen Leben völlig aus.
In unserer direkten Umgebung gab es sehr unterschiedliche Reaktionen auf die nun staatlich geförderte Judenfeindlichkeit. Für viele bürgerlich geprägte Zeitgenossen war militanter Antisemitismus schlicht indiskutabel. Wenn zum Beispiel Schuljungs Zettel an Laternenmasten klebten mit dem Schlachtruf “Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht´s noch mal so gut”, dann habe ich mit Freunden die Dinger wieder runtergerissen, und wir fühlten uns da in Einklang mit vielen Mitbürgern. Einer unserer Nachbarn war in der Partei, der hat meinen Vater immer gegrüßt, und seine Frau verschaffte meiner Mutter immer wieder Aushilfsarbeiten – während fast alle früheren Freunde uns seit 1933 eindeutig schnitten. Ich erinnere mich besonders an eine Bekannte meiner Mutter, die jahrelang Klientin eines jüdischen Arztes war, obwohl ihr Mann “Alter Kämpfer” war, also eingefleischter Nazi. Wir haben diese Familie oft besucht, ich bin mit deren Sohn über die Äcker gestreift, während sich die Eltern miteinander unterhielten. Nach 1933 kam diese Bekannte meiner Mutter irgendwann zu Besuch und erklärte uns, sie habe jetzt einen anderen Arzt. Dann schenkte sie mir 30 Pfennige und ging. Ich habe sie nie wieder gesehen.
Nur noch wenige hielten offen zu uns. Zwar kamen später im Krieg sogar manchmal Parteimitglieder vorbei und schenkten uns Lebensmittel, aber nur heimlich, spät abends in der Dunkelheit. Die einzigen Freunde meines Vaters waren andere Drangsalierte, nämlich kommunistisch denkende Kollegen aus der Pflichtarbeit.
Die Nürnberger Gesetze hatten Juden in Mischehen und ihre Nachkommen zunächst nicht völlig entrechtet. Meine Schwester und ich wurden durch diese Gesetze zu “Mischlingen ersten Grades”, und wir hatten im Laufe der Jahre unsere bitteren Erfahrungen mit diesem Status: Meine Schwester durfte nicht heiraten und musste ihren Sohn Wolfgang unehelich zur Welt bringen; und mir wurde 1944 ein Ingenieurstudium verwehrt.
Doch ziemlich lange habe ich kaum zu spüren bekommen, dass ich als “Halbjude” galt. Im zweiten Lehrjahr der Berufsschule bekam ich sogar einen Preis für gute Leistungen: “Mit Hitler an die Macht”, ein Buch von Goebbels. Richtig schlimm wurde es erst mit der Pogromnacht im November 1938. Da kam der Vater meines Schulfreundes Guttmann, früherer Besitzer einer Buchhandlung in der Marienstraße, völlig verstört und verängstigt, und suchte nachts Unterschlupf bei uns. Sein Sohn war längst nach Südamerika ausgewandert, aber dergleichen kam für uns nicht in Frage – wir hatten kein Geld, und außerdem gab es ja noch Vaters Eisernes Kreuz aus dem Ersten Weltkrieg als Talisman gegen ernsthafte Gefahr.
Ein Jahr zuvor hatten wir umziehen müssen, weil jemand das Wort “Jude” an unser Wohnhaus geschmiert hatte. Der Vermieter, weder Nazi noch Antisemit, bekam es ganz banal mit der Angst zu tun und hat uns gekündigt. Wir fanden eine neue Wohnung in einem Haus, das einem jüdischen Fabrikanten gehörte, und damit war im engsten Umfeld wieder alles relativ normal. Dieser Hausbesitzer musste die Immobilie später der Stadt Stuttgart übereignen. Danach wurde ich aufgefordert, im Wohnungsamt zu erscheinen. Ein städtischer Beamter, dem offensichtlich sehr unwohl in seiner Haut war, schlug mir vor, dass ich und meine Schwester uns von unserem Vater trennen sollten, damit das Haus judenfrei würde. Ich lehnte höflich ab, der Beamte gab eine wenig energische Antwort (“Sie können sich’s ja noch mal überlegen…”), dann war ich entlassen. Das Wohnugsamt hat sich nie wieder bei uns gemeldet.
1938 wurde ich zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Ich weiß noch gut, dass meine damals schon schwerkranke Mutter strahlte vor Glück, als sie mich das erste Mal in der Uniform des Arbeitsdienstes sah. Nach ihrem Tod noch im selben Jahr war es wohl vor allem mein Status als Aufbauhelfer und später dann als Soldat des Vaterlandes , der meinen Vater schützte. Ich kam ins gleiche Regiment wie schon mein Vater. Dort habe ich den Krieg erst an der Westfront mitgemacht, und nach dem schnellen Sieg über Frankreich kam ich mit meiner Einheit im Herbst 1940 zurück in die Cannstatter Kaserne. So konnte ich Abende und Wochenenden zu Hause bei meiner Schwester und meinem Vater verbringen.
Im Frühsommer 1941 kam der Marschbefehl nach Osten, der Russlandfeldzug begann. Seitdem hatte ich nur noch per Feldpost Kontakt nach Hause, und von dort kamen keine besonderen Nachrichten. Mein Vater machte weiter seine Pflichtarbeit in einer Cannstatter Radiofabrik, meine Schwester führte den Haushalt. Ich hatte das Glück, nur leicht verletzt zu werden, und rückte immer weiter vor nach Osten, bis wir im Winter 1942 in irgendeiner Kate kurz vor Moskau lagen. Einige Wochen zuvor hatte es bei der Wehrmacht eine erste Anfrage der NSDAP-Ortsgruppe Leonhardsplatz gegeben, wo die jüdische Abstammung meines Vaters aufgefallen war. Die Sache war zunächst im Sande verlaufen; nur einige Vorgesetzte wussten davon, und die meinten, es sei bedeutungslos. Aber das war ein Irrtum. Die Partei insistierte, und kurz darauf wurde ich aus der Wehrmacht entlassen.
Die Rückfahrt mit der Bahn war eine lange, beschwerliche Reise. Nach fast einer Woche kam ich mitten in der Nacht daheim in der Olgastraße an. Das Haus war dunkel, niemand reagierte auf mein Läuten. Schließlich suchte ich kleine Steinchen und warf sie gegen die Fensterscheiben unserer Wohnung. Davon wurde mein Vater geweckt, der mich einließ und mit den Worten begrüßte: “Es wundert mich nicht, dass sie dich weggeschickt haben. Alles ist so viel schlimmer geworden.” Mein Vater war tatsächlich sehr isoliert. Für mich dagegen ging das Leben fast normal weiter. Zwar durfte ich nicht studieren, aber in meiner alten Firma war ich hoch willkommen. Da wegen des Krieges überall Arbeitskräfte fehlten, konnte ich sofort wieder meine Stelle im Konstruktionsbüro antreteten.
Dann, im Januar 1944, rief mich meine Schwester morgens während der Arbeit an. “Komm schnell nach Hause”, sagte sie, und ich wusste sofort: Vater ist abgeholt worden. Er hatte ein paar Minuten Zeit gehabt, einen kleinen Koffer zu packen, und war dann zur Synagoge in der Hospitalstraße gebracht worden. Am Nachmittag konnten wir ihn dort besuchen. Der Raum war voller verunsichter Leute – allesamt Juden aus Mischehen und ihre Verwandten deutscher Abstammung. “Immerhin bringen sie mich nur nach Theresienstadt”, sagte mein Vater, “es hätte auch viel schlimmer kommen können.” Niemand musste einem erklären, was damit gemeint war. Die Geschichte eines Bekannten machte die Runde, der sich umgebracht hatte, um der Deportation zu entgehen.
Am elften Januar 1944 wurde mein Vater zum Nordbahnhof gebracht und von dort aus mit den üblichen unbeheizten Viehwaggons nach Theresienstadt. Dorthin durften wir ihm pro Familienmitglied ein Päckchen pro Monat schicken. Ich erfand einen Bruder namens Fritz, und so konnten wir jede Woche Lebensmittel ins KZ schicken; die Identität der Absender wurde offenbar nie geprüft. Natürlich wussten wir nie, ob er wirklich bekam, was wir ihm wöchentlich schickten. Aber im Laufe der Monate erreichten uns insgesamt sechs Postkarten von ihm. Er schrieb unter anderem:
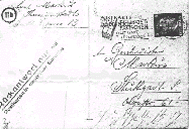 “Theresienstadt, d. 17. Juli1944 Meine Lieben! Zuerst lb. Emil herzl. Glückwünsche zu Deinem Geburtstage und das Allerbeste für Deine Zukunft. Ich habe nun weitere 6 Karten, die letzte vom 31.5. erhalten.(…) Es sind bisher 24 Sendungen gut und frisch hier eingetroffen. Alles war für mich sehr wertvoll, Butter und Marmelade waren ausgezeichnet. Wir haben hier eine warme Küche zum Kochen. Wäsche habe ich jetzt genügend. Freue mich schon sehr auf Fotos. Ich bin noch gesund. Schreibt bitte bald wieder. Grüße an (…) alle, die nach mir fragen. Euch meine Lieben die innigsten Grüße von Eurem Vater und Großvater Emil Markus.”
“Theresienstadt, d. 17. Juli1944 Meine Lieben! Zuerst lb. Emil herzl. Glückwünsche zu Deinem Geburtstage und das Allerbeste für Deine Zukunft. Ich habe nun weitere 6 Karten, die letzte vom 31.5. erhalten.(…) Es sind bisher 24 Sendungen gut und frisch hier eingetroffen. Alles war für mich sehr wertvoll, Butter und Marmelade waren ausgezeichnet. Wir haben hier eine warme Küche zum Kochen. Wäsche habe ich jetzt genügend. Freue mich schon sehr auf Fotos. Ich bin noch gesund. Schreibt bitte bald wieder. Grüße an (…) alle, die nach mir fragen. Euch meine Lieben die innigsten Grüße von Eurem Vater und Großvater Emil Markus.”
Auch wenn wir wegen der Zensur nie wussten, was von diesen Worten der Wirklichkeit entsprach, waren wir zuversichtlich. Immerhin lebte unser Vater noch.
Ich selber wurde im Sommer 1944 zu Hilfsdiensten für die Wehrmacht eingezogen. Die Alliierten waren in der Normandie gelandet, und nun schien die deutsche Armee sogar die eben noch verschmähten “Halbjuden” zu brauchen. Ich musste in den Vogesen Panzergräben ausheben, und kam erst an Heiligabend 1944 zurück nach Stuttgart. Meine Schwester erwartete mich mit der niederschmetternden Botschaft, dass es schon seit Oktober keine Nachricht mehr von unserem Vater gegeben hatte.
Um Hilfe oder wenigstens Auskünfte zu bekommen, ging ich zu dem jüdischen Rechtsanwalt Dr.Ostertag, der wohl wegen seiner deutschen Frau noch nicht deportiert worden war. Ich läutete, aber nichts im Haus regte sich. Ich ließ nicht locker und versuchte es immer wieder, und nach sehr vielen Versuchen öffnete Ostertag endlich einen Spalt breit die Tür. Er erkannte mich und fragte: “Was tun Sie denn hier, wieso sind Sie nicht ins Lager gebracht worden?” Wahrscheinlich war das Chaos der Bombardierungen und des sich auflösenden Alltagslebens meine Rettung. Unser Wohnhaus in der Olgastraße lag in Trümmern, irgendwie fand ich einen Unterschlupf in Weil im Dorf. Falls die Nazis mich suchten, hatten sie keine Anhaltpunkte für meinen Aufenthaltsort. – Ich berichtete Ostertag vom Grabenbau für die Wehrmacht und dem Verstummen meines Vaters. Ratlos hörte er zu und schickte mich schließlich wieder weg.
Mein Vater blieb stumm. Nach Kriegsende hörte ich, dass KZ-Überlebende im Erholungsheim des CVJM bei den Sportplätzen der Waldau ankommen würden. Am betreffenden Tag fuhr ich mit der Straßenbahn hin. Ich weiß noch genau, wie ich voller Vorfreude und banger Hoffnung von der Haltestelle Waldau das Königsträßle hinaufrannte, um meinen Vater wieder zu sehen. Doch ich wurde enttäuscht. Einige der Überlebenden hatten meinen Vater zwar gekannt, aber niemand wusste Genaues über ihn. Erst eine Recherchestelle in Prag, die Jewish Agency, konnte uns Klarheit geben: Mein Vater war am 1. Oktober 1944 von Theresienstadt nach Auschwitz gebracht worden, mit dem letzten Transport dieser Art.
Alles, was meiner Schwester und mir von unserem Vater geblieben ist, sind sechs Postkarten aus Theresienstadt, seine Taschenuhr, sein Militärpass, ein paar Fotos – und die Erinnerung an einen Menschen, der sein Lebtag niemandem ein Leid zugefügt hat.”
 Am 23. September 2005 konnte Emil F. Markus dabei sein, als Gunter Demnig den Stolperstein verlegte, der an das Schicksal seines Vaters erinnern soll. Der Stein wurde in die Gehwegplatten am ehemaligen Standort des Wohnhauses der Familie in der Olgastraße 61 einbetoniert.
Am 23. September 2005 konnte Emil F. Markus dabei sein, als Gunter Demnig den Stolperstein verlegte, der an das Schicksal seines Vaters erinnern soll. Der Stein wurde in die Gehwegplatten am ehemaligen Standort des Wohnhauses der Familie in der Olgastraße 61 einbetoniert.
Aufgezeichnet von Andreas Langen, Stolpersteininitiative Stuttgart-Mitte
Fotos: Andreas Langen, Michael Bräunicke
Pate/Spender des Kleindenkmals: Franz-Josef und Heike Laufer-Markus
Eine ausführlichere Version der Erinnerungen von Emil Markus finden Sie in dem im Herbst im Markstein-Verlag erschienenen Buch “Stuttgarter Stolpersteine- Spuren vergessener Nachbarn”.




